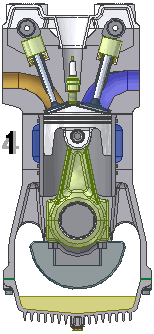Unsere Offnungszeiten
Montags- Freitags
von 7:00 bis 19:00 Uhr
Samstags
von 8:00 bis14:00 Uhr
EMail
mail@autopark-ingelheim.de
Abschlepp-Service
außerhalb unserer
Geschäftszeiten:
Service - Tel. Nr.
06725 - 963156
Tel: 06132-78390
Fax: 06132-783940



Wir suchen ständig Gebrauchtwagen und Transporter aller Marken!
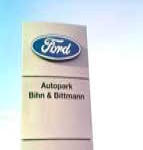
Abschlepp-Service
außerhalb unserer
Geschäftszeiten:
Service - Tel. Nr.
06725 - 963156
Funktionsweise
Das Einbringen des Kraftstoffs erfolgt durch einen Vergaser oder über eine
(heute meist elektronisch gesteuerte) Benzineinspritzung in den Ansaugbereich oder in
den Brennraum des Motors. Mit Hilfe einer Zündkerze wird kurzzeitig ein
elektrischer Funkenüberschlag, der Zündfunke, erzeugt, mit dem das Gemisch zur
zeitlich genau kontrollierten Explosion gebracht wird. Durch die sich stark
ausdehnenden Verbrennungsprodukte entsteht ein sehr hoher (über 100 bar) Druck im
Zylinder, der den Kolben in geradliniger Bewegung wegschiebt. Über die Pleuelstange
wird diese Bewegung dann in die rotierende Bewegung der Kurbelwelle und die
gewünschte mechanische Arbeit umgesetzt. Als Kraftstoff für Ottomotore dient
hauptsächlich Benzin, aber auch Flüssiggas, Erdgas und Wasserstoff kann abhängig
von den Motoreinstellungen wie Zündzeitpunkt,
Verdichungsverhältnis, Verbrennunsluftüberschuss verwendet
werden.
Ottomotoren können prinzipiell als Zweitaktmotor oder als
Viertaktmotor ausgeführt sein, wobei der Viertaktmotor die
inzwischen gebräuchlichere Bauart ist.
·
Fremdzündung: Das Gemisch wird zu einem definierten
Zeitpunkt durch den Funken einer Zündkerze gezündet;
es zündet (im Gegensatz zum Dieselmotor) nicht selbst.
·
Äußere Gemischbildung: Kraftstoff und Luft werden vor
dem Brennraum gemischt, und nicht erst im Zylinder wie
beim Dieselmotor.
·
Motorleistungsregelung: Die Leistung wird mit einer
Drosselklappe über die Menge des zugeführten
Kraftstoff-Luft-Gemisches geregelt. (Beim Dieselmotor
erfolgt sie über die Menge des eingespritzten
Dieselkraftstoffes.)
An die letzten beiden Merkmale halten sich "Benzin-Direkteinspritzer" (FSI- und
GDI-Motoren) allerdings nicht mehr so genau. Direkteinspritzung des Kraftstoffes in
den Brennraum ist nicht mehr an die Einlaßsteuerzeiten der Ventile gebunden und
kann auch erst später in der Verdichtungsphase erfolgen. Außerdem werden mit dieser
Technik Schichtladungen (Zonen im Zylinder mit unterschiedlicher
Gemischzusammensetzung) ermöglicht (siehe Magermotor), bei denen zündfreudiges,
fettes, stöchiometrisches Gemisch (d. h. 14,7 Teile Luft : 1 Teil Kraftstoff) im Bereich
der Zündkerze und mageres Gemisch im restlichen Brennraum eingestellt wird. Bei
einem Motor mit homogener Kompressionszündung hingegen wird die gesamte
Ladung geregelt und gleichmäßig ohne Zündkerze gezündet.
Geschichte
Der Ottomotor, 1876 patentiert, wurde 1862 von Nikolaus August Otto auf Basis des
1860 erfundenen, erheblich leistungsschwächeren 3-Takt-Gasmotors von Lenoir
entwickelt. Die wesentliche Neuerung war die Einführung eines Verdichtungstaktes.
Ottos erste Konstruktion hatte allerdings mit den heutigen Motoren wenig
Ähnlichkeit. Es handelte sich um einen atmosphärischen Motor, das heißt die
Explosion schleuderte den Kolben hinaus, der frei wegflog. Erst auf dem Rückweg
leistete er (beziehungsweise der Atmosphärendruck) über eine Zahnstange Arbeit.
1864 war Nikolaus August Otto Mitbegründer der Motorenfabrik N. A. Otto & Cie. in
Köln (aus der später die heutige Deutz AG hervorging). Dort wurden ab 1876
Ottomotoren hergestellt. 1876 erwarb Otto in Deutschland ein Patent auf einen
Verbrennungsmotor, welches auch das Viertakt-Prinzip mit einschloss. Wegen älterer
Ansprüche des Franzosen Alphonse Beau de Rochas wurde das Otto-Patent 10 Jahre
später in Deutschland aufgehoben.
Gottlieb Daimler und Carl Benz bauten 1886, unabhängig davon 1888 bis 1889 in
Wien Siegfried Marcus, die ersten Kraftfahrzeuge mit einem Ottomotor.
Der Begriff Ottomotor geht zurück auf eine Anregung des VDI aus dem Jahre 1936
und wurde erstmals im Jahre 1946 in der DIN Nr. 1940 verwendet.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren Hubräume von 0,4 Litern und sogar bis zu 13,5
Litern (Pearce Arrow) üblich, während sich heutigen Tags der Hubraum bei 1,0 bis 3,0
Liter eingependelt hat.
Quelle: Wikipedia